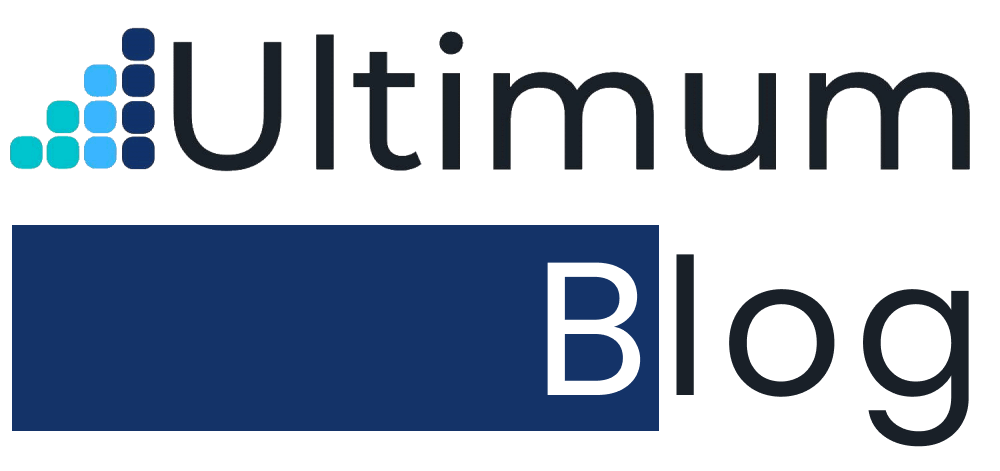Glücksspiel ist in Österreich ein bisschen wie ein exklusiver Club, wo der Staat den Türsteher spielt und entscheidet, wer mitmachen darf. Doch während das Monopol offiziell noch besteht, tanzen draußen längst hunderte Anbieter in der Grauzone. Online-Casinos aus Malta oder Gibraltar lassen sich von österreichischen Gesetzen nicht beeindrucken. Die Spieler nutzen sie trotzdem und der Staat schaut dabei zu, wie Millionen an Steuereinnahmen ins Ausland verschwinden.
Die Idee, das Monopol abzuschaffen und den Markt zu öffnen, liegt also auf dem Tisch. Die große Frage dabei ist, ob das für Österreichs Steuerkasse ein Jackpot oder ein Fehlgriff werden könnte.
Wie hoch sind die aktuellen Steuereinnahmen durch das Glücksspielmonopol?
Glücksspiel bringt Geld und das nicht nur für die Spieler, die gewinnen, sondern vor allem für den Staat. Jedes Jahr fließen Millionen an Steuern aus Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien direkt in die Staatskasse. Dabei wird auf verschiedenen Wegen mitverdient, etwa durch Glücksspielabgaben, Unternehmenssteuern und in manchen Fällen durch Umsatzsteuer.
Selbst die Anbieter, die illegal agieren oder besser gesagt in einer Grauzone, bezahlen schon jetzt teilweise Steuern. Neben den Angeboten des Monopols gibt es viele weitere Anbieter, wie man auf der Webseite Casino Groups nachlesen kann und diese haben zwar Lizenzen, aber diese werden von Österreich nicht anerkannt. Dies lässt das Monopol noch sinnloser wirken und zudem hat dieses System einen gewaltigen Haken, denn während die legalen Anbieter brav ihre Abgaben leisten, gibt es einen florierenden Schwarzmarkt. Das bedeutet, der Staat verdient nur an einem Teil des Marktes, während sich ein riesiger Batzen der Einnahmen unerfasst ins Ausland verabschiedet.
Ein Monopol klingt nach Kontrolle, sorgt in der Praxis aber dafür, dass sich ein großer Teil des Geschäfts außerhalb der Reichweite der Behörden bewegt. Eine Marktöffnung könnte genau hier ansetzen.
Welche neuen Steuereinnahmen wären durch eine Marktöffnung möglich?
Ein offener Glücksspielmarkt könnte Österreich steuerlich eine ganz neue Spielwiese bieten, denn während aktuell nur eine Handvoll Anbieter zur Kasse gebeten wird, könnte eine Lizenzvergabe an private Unternehmen für eine regelrechte Steuerexplosion sorgen.
Ein realistisches Szenario wäre eine Kombination aus verschiedenen Einnahmequellen. Anbieter, die in Österreich legal operieren wollen, könnten eine allgemeine Lizenzgebühr zahlen müssen, entweder einmalig oder jährlich. Auf ihre Bruttospielerträge, also das, was nach Gewinnausschüttungen übrig bleibt, könnten Steuern erhoben werden. Auch Unternehmenssteuern kämen ins Spiel, wenn sich neue Glücksspielanbieter tatsächlich in Österreich ansiedeln.
Eine besonders interessante Schraube wäre die Umsatzsteuer, denn viele Online-Casinos agieren derzeit von außerhalb der EU, wodurch sie sich geschickt um diese Abgabe drücken. Mit einer Regulierung könnte dieser Hebel wieder angesetzt werden.
Schweden hat diesen Weg bereits beschritten und seit der Marktöffnung sprudeln dort die Steuereinnahmen, weil ehemals illegale Anbieter plötzlich legalisiert und damit steuerpflichtig wurden. Das zeigt, wer das Geld nicht aus der Tür werfen will, muss ein System schaffen, in dem es bleibt.
Wie könnten unterschiedliche Glücksspielformen besteuert werden?
Nicht jedes Glücksspiel ist gleich. Während ein Lottoschein für die meisten ein gelegentliches Vergnügen bleibt, können Automatenspiele oder Online-Poker eine ganz andere Dynamik entwickeln. Eine kluge Steuerpolitik müsste also unterscheiden. Lotterien könnten weiterhin moderat besteuert bleiben, da sie in der Regel keine hohe Suchtgefahr bergen. Bei Online-Casinos und Spielautomaten sähe es anders aus. Dort könnte eine höhere Steuerlast angesetzt werden, um das exzessive Spielen zumindest finanziell unattraktiver zu machen.
Poker und andere Geschicklichkeitsspiele könnten steuerlich in eine Sonderkategorie fallen, da hier nicht alles reiner Zufall ist. Zudem könnte man die Sportwetten, die in Österreich bislang steuerlich bevorzugt, werden ebenfalls als Glücksspiel einstufen und so könnte sich auch hier das Steueraufkommen drastisch erhöhen.
Steuern haben in diesem Fall eine doppelte Funktion, denn einerseits füllen sie die Staatskasse, andererseits könnten sie auch als Lenkungsinstrument eingesetzt werden. Wer hohe Abgaben auf besonders problematische Spielformen erhebt, kann zumindest steuerlich regulierend eingreifen.
Welche Auswirkungen hätte die Neuregelung von Sportwetten auf die Steuereinnahmen?
Ein besonders kurioses Detail im österreichischen Steuersystem ist die Behandlung von Sportwetten. Während klassische Glücksspiele streng reguliert sind, gelten Wetten als Geschicklichkeitsspiel mit entsprechend niedriger Steuerlast. Diese Sonderstellung ist längst überholt, weil Buchmacher kein Interesse daran haben, nur erfahrene Tipper zu gewinnen, die kluge Strategien nutzen. Der größte Umsatz entsteht durch spontane Wetten, emotionale Einsätze und den Reiz des schnellen Geldes.
Eine neue Klassifizierung würde für den Staat eine lukrative Steuerquelle öffnen. Höhere Abgaben für Wettanbieter könnten die Einnahmen deutlich steigern und gleichzeitig würden strengere Regulierungen helfen, den Markt transparenter zu gestalten. Deutschland hat diesen Schritt bereits gemacht, dort wird eine Steuer auf Wettumsätze erhoben, was die Steuereinnahmen in diesem Bereich massiv gesteigert hat. Österreich könnte sich daran ein Beispiel nehmen.
Welche Kosten würden durch eine Marktliberalisierung entstehen?
Natürlich hat das Ganze auch eine Schattenseite, weil mehr Anbieter mehr Verwaltungsaufwand bedeuten. Eine Glücksspielbehörde müsste entweder ausgebaut oder neu geschaffen werden, um Lizenzen zu vergeben und den Markt zu kontrollieren.
Ein weiteres Problem ist der Spielerschutz, weil mit einer größeren Anzahl an legalen Anbietern auch das Risiko für problematisches Spielverhalten steigt. Ein zentral geführtes Sperrregister könnte dabei helfen, indem es verhindert, dass suchtgefährdete Spieler unkontrolliert weiterspielen.
Auch Präventionsmaßnahmen müssten ausgebaut werden. Informationskampagnen, Beratungsangebote und Therapieeinrichtungen würden zusätzliche Mittel benötigen. Ein nicht unerheblicher Teil der neuen Steuereinnahmen müsste daher direkt in Regulierungs- und Schutzmaßnahmen fließen. Die Frage ist also nicht nur, wie viel Geld hereinkommt, sondern auch, wie viel davon gleich wieder ausgegeben werden muss.
Würde eine Marktöffnung illegales Glücksspiel eindämmen oder verstärken?
Die Hoffnung wäre, dass durch eine Marktöffnung illegale Anbieter überflüssig werden. Schließlich wäre der Anreiz für Spieler gering, auf undurchsichtige Offshore-Seiten auszuweichen, wenn es attraktive legale Alternativen gibt. Das funktioniert allerdings nur unter einer Bedingung. Die neuen Steuern und Regulierungen dürfen nicht übertrieben restriktiv sein. Wenn Anbieter durch hohe Abgaben oder komplizierte Auflagen abgeschreckt werden, könnten Spieler weiterhin nach Alternativen suchen. Die Erfahrung zeigt, dass Märkte mit kluger Regulierung den Schwarzmarkt deutlich reduzieren können. Eine unausgegorene Marktöffnung hingegen kann genau das Gegenteil bewirken.
Fazit: Steuerliche Chancen und Risiken einer Abschaffung des Glücksspielmonopols
Eine Abschaffung des Glücksspielmonopols wäre wirtschaftlich ein großer Schritt. Eine kontrollierte Marktöffnung könnte die Steuereinnahmen massiv steigern, illegale Anbieter zurückdrängen und den Markt transparenter machen. Doch eine Reform ist kein Selbstläufer, denn ohne eine durchdachte Steuerpolitik und eine starke Regulierung könnte der Schuss nach hinten losgehen. Ein zu lasches Modell würde zu Chaos führen, während ein überregulierter Markt weiterhin den Schwarzmarkt befeuern könnte.
Glücksspiel wird es immer geben, die entscheidende Frage ist nicht, ob gespielt wird, sondern ob der Staat mitverdient oder ob er weiterhin zusieht, wie Milliarden an ihm vorbeirauschen.