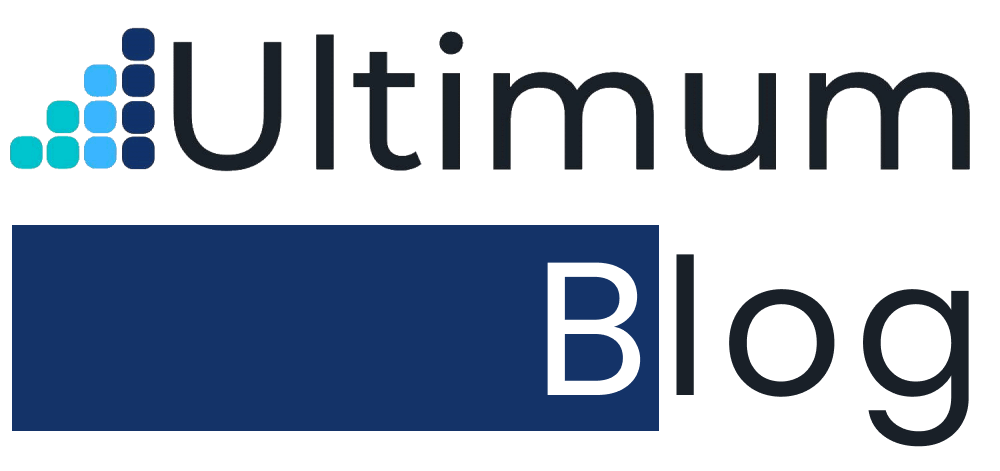Während Spieler im Casino oder beim Lotto auf den sprichwörtlichen Glücksmoment hoffen, schaut der Staat nüchtern auf die Zahlen. Denn auch wenn Gewinne in Österreich für Privatpersonen meist steuerfrei sind, entgeht dem Fiskus nichts. Über Umwege sichert er sich seinen Anteil und die Summen, die dabei jedes Jahr in die Kassen fließen, sind beträchtlich.
Die spannende Frage lautet also nicht, wie hoch die Gewinne der Spieler ausfallen, sondern wo genau der Staat beim Glücksspiel mitverdient und an welcher Stelle er großzügig auf eine Besteuerung verzichtet.
Was in Österreich überhaupt als Glücksspiel gilt
Um die Spielregeln in Österreich zu verstehen, lohnt sich ein Blick ins Gesetz. Glücksspiel liegt nach der Definition immer dann vor, wenn der Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Das klingt trocken, lässt sich aber leicht veranschaulichen: Lottozahlen, Roulettekugel oder Spielautomaten – sie alle folgen keinem Muster, das berechenbar wäre. Genau deshalb fallen sie in die Kategorie Glücksspiel.
Spannender wird es bei den Sportwetten. Hier entscheidet theoretisch nicht nur der Zufall, sondern auch das Fachwissen über Teams, Spieler und Taktik. Deshalb gelten Sportwetten rechtlich in Österreich als Geschicklichkeitsspiel.
Der Haken ist, dass die steuerliche Behandlung kaum einen Unterschied macht, denn auch bei Wetten greift der Staat zu. Während also beim Roulette klar ist, dass der Zufall regiert, bleibt bei der Fußballwette ein Rest an Strategie – steuerlich betrachtet spielt das allerdings kaum eine Rolle.
Steuerpflicht oder Steuerfreiheit: Welche Gewinne sind für Spieler relevant?
Eine Frage sorgt regelmäßig für Stirnrunzeln: Müssen Gewinne aus dem Glücksspiel in Österreich versteuert werden? Die Antwort ist zunächst erfreulich einfach. Für Freizeitspieler sind Gewinne grundsätzlich steuerfrei. Ob also die Lottoziehung zum Glückstag wird oder die Jetons im Casino richtig platziert wurden, der Gewinn darf ohne Abzüge behalten werden.
Anders sieht es aus, wenn Glücksspiel nicht mehr bloßer Zeitvertreib, sondern professionell betrieben wird. Wer etwa als Pokerspieler seinen Lebensunterhalt verdient oder systematisch mit Sportwetten handelt, bewegt sich in einer völlig anderen steuerlichen Liga. Dann werden die Einnahmen als Einkünfte betrachtet und unterliegen der Einkommensteuer.
Die Abgrenzung zwischen Hobby und Beruf ist allerdings nicht immer leicht zu ziehen. Kriterien wie Häufigkeit, Systematik oder die Absicht, dauerhaft Gewinne zu erzielen, spielen eine entscheidende Rolle. Die meisten bleiben jedoch Freizeitspieler. Das bedeutet, dass das Glück im Spiel steuerlich nicht bestraft wird. Diese Steuerfreiheit ist einer der Gründe, warum Österreich im Vergleich zu anderen Staaten als besonders spielerfreundlich gilt.
Wo der Staat beim Glücksspiel tatsächlich kassiert
Wenn der Staat nicht bei den Spielern selbst ansetzt, bleibt nur die Möglichkeit, die Anbieter zur Kasse zu bitten. Genau hier schlägt die Stunde der Glücksspielabgabe.
Staatlich konzessionierte Betreiber wie Casinos Austria zahlen je nach Art des Spiels einen bestimmten Prozentsatz auf die Einsätze. Bei den meisten Glücksspielen sind es 16 Prozent, bei Lotterien ohne Erwerbszweck 12 Prozent und bei gemeinnützigen Lotterien nur 5 Prozent. Auch Gewinnspiele, die ohne Einsatz stattfinden, sind nicht steuerfrei. Hier fällt eine Abgabe von 5 Prozent des Gewinnwerts an.
Besonders umstritten ist die Abgabe bei Sportwetten. Für jeden getätigten Einsatz müssen Anbieter 5 Prozent als Wettgebühr abführen. Diese Gebühr wird direkt beim Anbieter fällig, nicht beim Spieler. Der Gewinn bleibt also unberührt, während der Staat bereits beim Einsatz seinen Anteil sichert.
So ergibt sich ein klares Bild: Spieler genießen weitgehende Steuerfreiheit, Anbieter tragen dagegen eine erhebliche Last. Auf diese Weise wird das Glück in klingende Münzen für die Staatskasse verwandelt.
Steuererhöhungen der letzten Jahre – mehr Einnahmen oder Belastung für die Branche?
Im Frühjahr 2025 wurden die Karten neu gemischt. Die Regierung erhöhte die Wettgebühr von 2 auf 5 Prozent und verschärfte zugleich die Abgaben im Glücksspielbereich. Die Begründung sind zusätzliche Einnahmen für den Staatshaushalt.
Laut Finanzministerium sollen damit allein im Jahr 2025 rund 50 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen gespült werden. Bis 2026 rechnet man mit 129 Millionen Euro Mehreinnahmen, und für die Jahre 2028/29 ist von jährlich rund 200 Millionen Euro die Rede.
Auf dem Papier klingt das nach einem großen Gewinn für die Staatsfinanzen. Doch nicht alle teilen diesen Optimismus. Vertreter der Glücksspielbranche warnen davor, dass die höheren Abgaben die Wirtschaftlichkeit massiv belasten. Bei Casinos Austria steht sogar die Schließung einzelner Standorte im Raum. Auch Online-Anbieter rechnen mit spürbaren Einbußen, da die Margen schrumpfen und damit die Konkurrenzfähigkeit sinkt.
Es bleibt also abzuwarten, ob die Rechnung tatsächlich aufgeht. Höhere Steuern garantieren nicht automatisch höhere Einnahmen. Wenn Anbieter den Markt verlassen oder Spieler auf ausländische Plattformen ausweichen, könnte der Schuss nach hinten losgehen. Der Staat spielt in gewisser Weise selbst ein riskantes Spiel.
Internationale Anbieter mit EU-Lizenzen machen den Markt kompliziert
Der Glücksspielmarkt endet nicht an der österreichischen Grenze. Viele Anbieter haben ihren Sitz im EU-Ausland, häufig in Malta oder Gibraltar, und verfügen dort über gültige Lizenzen. Diese Unternehmen dürfen in Österreich offiziell nicht operieren, sind aber dennoch aktiv. Sie werben mit schnellen Auszahlungen, die nur wenige Augenblicke dauern, hohen Sicherheitsstandards und einem breiten Angebot an Spielen.
Das Besondere ist die rechtliche Grauzone. Auf EU-Ebene gilt die Dienstleistungsfreiheit, wodurch sich die Anbieter gestärkt fühlen. Viele setzen darauf, dass der Europäische Gerichtshof ihre Lizenzen irgendwann auch in Österreich anerkennen wird.
So entsteht ein kurioses Szenario: Anbieter, die rechtlich nicht zugelassen sind, verhalten sich, als ob sie es wären. Manche gehen sogar so weit, bereits Steuern abzuführen, um auf der sicheren Seite zu stehen, falls der EuGH tatsächlich grünes Licht gibt.
Für den Staat ist das eine schwierige Situation. Einerseits möchte er das Glücksspiel streng regulieren und unter Kontrolle halten, andererseits ist die europäische Rechtslage nicht eindeutig. Noch schwieriger wird es, wenn Anbieter Einzahlungen mit Kryptowährungen erlauben, sodass ein weiteres komplexes Steuergebiet tangiert wird.
Wohin sich das Glücksspiel in Österreich entwickelt
Am Ende bleibt ein Spannungsfeld, das so leicht nicht aufzulösen ist. Auf der einen Seite die klare Steuerfreiheit für Privatpersonen, die das Gewinnen zu einem unverfälschten Glücksmoment macht. Auf der anderen Seite stehen Anbieter, die mit wachsenden Abgaben konfrontiert sind und deren Existenz teilweise infrage gestellt wird.
Die jüngsten Steuererhöhungen sollen dem Staat langfristig hunderte Millionen Euro bringen, doch ob die Prognosen eintreffen, ist unsicher. Wenn Anbieter unter der Last zusammenbrechen oder Spieler vermehrt auf internationale Plattformen ausweichen, könnte das gewünschte Ergebnis ausbleiben. Gleichzeitig wächst der Einfluss ausländischer Anbieter, die sich in Erwartung europäischer Urteile zunehmend selbstbewusst positionieren.
Das Glücksspiel in Österreich bleibt damit ein Spiel mit offenem Ausgang. Für Spieler ist es ein Feld ohne steuerliche Stolperfallen, für Anbieter dagegen ein Terrain voller Pflichten, Gebühren und Abgaben. Der Staat hofft auf stabile Einnahmen, die Branche kämpft mit den Folgen, und internationale Anbieter lauern im Hintergrund.
Ob am Ende der Staat, die Unternehmen oder die Spieler den größten Vorteil ziehen, bleibt abzuwarten – sicher ist nur, dass das Spiel um das Glück auch in steuerlicher Hinsicht nie stillsteht.